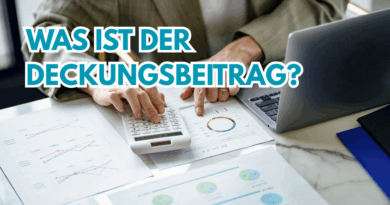Preisuntergrenzen einfach erklärt
Preisuntergrenzen gehören zu den spannendsten und praktischsten Konzepten der Betriebswirtschaftslehre. Sie sind nicht nur ein theoretisches Rechenthema, sondern beeinflussen täglich echte Entscheidungen in Unternehmen – vom Industriebetrieb bis zum Supermarkt.
Besonders interessant wird das Thema, wenn Märkte einbrechen, Produkte verderben oder Lagerkosten steigen. Dann stellt sich die Frage: Zu welchem Mindestpreis lohnt sich ein Verkauf überhaupt noch? Eenso wichtig: Wann richtet ein Verkauf kurzfristig weniger Schaden an als eine langfristige Lagerung oder gar das Wegwerfen?
Inhaltsverzeichnis
Was ist eine Preisuntergrenze?
Eine Preisuntergrenze gibt an, wie tief ein Unternehmen mit dem Preis gehen kann, bevor jeder weitere Verkauf wirtschaftlich unsinnig wird. In der BWL unterscheidet man zwei zentrale Formen:
-
die absolute Preisuntergrenze
-
die langfristige (relative) Preisuntergrenze
Beide Preisgrenzen erfüllen völlig unterschiedliche Funktionen und führen zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen.
Die absolute Preisuntergrenze
Die absolute Preisuntergrenze – auch kurzfristige Preisuntergrenze genannt – liegt dort, wo ein Produkt gerade noch seine variablen Kosten deckt. An diesem Punkt ist der Deckungsbeitrag null.
Formel: Verkaufspreis = variable Stückkosten
Das bedeutet: Das Unternehmen macht keinen Gewinn, aber auch keinen zusätzlichen Verlust durch die Produktion. Diese Untergrenze wird vor allem in Ausnahmesituationen relevant – etwa in wirtschaftlichen Krisen oder bei massiven Absatzproblemen.
Krisenszenario Industrie: Lagern oder günstig verkaufen?
Angenommen ein Autoproduzent sieht sich in einer Wirtschaftskrise mit einem dramatischen Nachfragerückgang konfrontiert. Tausende Fahrzeuge stehen bereits produziert auf dem Hof, aber zum geplanten Preis lassen sie sich nicht mehr absetzen. Das Unternehmen steht vor einer strategischen Entscheidung:
Option 1: Lagerung
Autos einfach stehenlassen, klingt simpel, führt aber zu erheblichen Kosten und Risiken:
-
Stellplatz- und Lagerkosten
-
hoher Wertverlust über die Zeit
-
Risiko von Witterungsschäden
-
Modelle veralten, werden technologisch überholt
-
gebundenes Kapital, das nicht zur Verfügung steht
Ein in der Krise produziertes Fahrzeug kann nach fünf Jahren Wartezeit zwar noch „neu“ sein, ist aber dennoch ein altes Modell und damit stark entwertet. Die vermeintliche Schonung des Preises kann dadurch langfristig teurer sein als jeder kurzfristige Preisnachlass.
Option 2: Verkauf zur absoluten Preisuntergrenze
Eine Alternative ist der sofortige Abverkauf deutlich unter dem Listenpreis – teilweise sogar knapp an den variablen Kosten oder darunter. Das ist zwar kurzfristig schmerzhaft, aber:
-
die Liquidität verbessert sich sofort
-
Lagerkapazitäten werden frei
-
laufende Kosten sinken
-
das Risiko weiterer Entwertung entfällt
Unternehmen entscheiden sich häufig für diesen Schritt, wenn das Lagern teurer wäre als der unmittelbare Verlust.
Gefährliche Nebenwirkung: Preiserosion
Jede massive Rabattaktion hat eine Schattenseite: Kunden gewöhnen sich an niedrige Preise. Der Markt beobachtet solche Preissenkungen sehr genau, und es besteht die Gefahr, dass das Preisniveau dauerhaft sinkt. Im Einzelhandel ist dieser Effekt besonders sichtbar.
Handel und verderbliche Ware: Warum Supermärkte nicht alles verramschen können
Bei Produkten mit kurzer Haltbarkeit steht der Handel oft vor einem Dilemma: Sollen leicht verderbliche Waren schnell abverkauft oder vernichtet werden?
Ein Beispiel: Ein Karton Bananen mit einem Einstandspreis von 5 Euro könnte theoretisch kurz vor dem Verderb für 1 Euro verkauft werden. Das wäre betriebswirtschaftlich eine Schadensbegrenzung. Doch wenn Kunden regelmäßig erleben, dass frische Waren am Samstag verramscht werden, hat das unmittelbare Auswirkungen:
-
Die Zahlungsbereitschaft sinkt.
-
Kunden warten gezielt auf die Billigphasen.
-
Das ganze Preisgefüge des Marktes gerät ins Wanken.
Deshalb entscheiden sich viele Handelsketten bewusst gegen Niedrigstpreisaktionen – selbst wenn danach Ware entsorgt werden muss.
Zero Waste versus Preisstrategie: Ein Widerspruch?
Es gibt jedoch eine interessante Alternative, die ökonomisch und gesellschaftlich sinnvoller ist: statt Produkte weit unter Preis zu verkaufen oder wegzuwerfen, können Händler überschüssige Lebensmittel an Tafeln oder soziale Einrichtungen abgeben.
Das hat mehrere Vorteile:
-
Bedürftige werden unterstützt
-
gute Presse statt Preiserosion
-
keine Preisverdorbenheit im Markt
-
weniger Lebensmittelverschwendung
Der Gedanke passt sehr gut zur Zero-Waste-Idee, die darauf abzielt, Abfälle zu vermeiden und Ressourcen optimal zu nutzen. Reststoffe werden weiterverwertet – sei es in der Gastronomie, in der Produktion oder im Haushalt. Beispielsweise können aus vermeintlichen Großküchenabfällen wie Abschnitten und Schalen noch Brühen hergestellt oder Lebensmittelreste anderweitig verwertet werden. Auch aus unternehmerischer Sicht ergibt Zero Waste Sinn: Wer Abfälle vermeidet, senkt Kosten.
Die langfristige Preisuntergrenze: Rentabilität im Blick behalten
Während die absolute Preisuntergrenze eine kurzfristige Notlösung ist, zeigt die langfristige Preisuntergrenze, ob ein Produkt überhaupt wirtschaftlich tragfähig ist. Hier werden neben den variablen auch die fixen Kosten anteilig berücksichtigt:
Verkaufspreis = variable Kosten + fixe Kostenanteile
Erst wenn dieser Preis erreicht wird, deckt das Unternehmen alle Kosten und arbeitet langfristig stabil. Die langfristige Preisuntergrenze ist Grundlage für:
-
Preisstrategien
-
Break-even-Planungen
-
Investitionsentscheidungen
-
Sortimentspolitik
-
Produktions- und Kapazitätsentscheidungen
Kurzfristig kann ein Preis unterhalb der langfristigen Preisuntergrenze sinnvoll sein. Langfristig allerdings gefährdet er das Überleben des Unternehmens.
Fazit: Preisuntergrenzen sind mehr als eine Formel – sie steuern echte Entscheidungen
Preisuntergrenzen sind eine Kombination aus wirtschaftlicher Logik, strategischem Denken und manchmal auch ethischer Verantwortung. Sie beantworten nicht nur die Frage, wie tief ein Preis fallen darf, sondern auch:
-
Wann lohnt sich ein Abverkauf?
-
Wann lohnt sich das Lagern nicht mehr?
-
Wie schützt man das Preisgefüge des eigenen Marktes?
-
Wie geht man sinnvoll mit verderblicher Ware um?
-
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit oder Zero Waste?
Ob in der Industrie, im Handel oder im privaten Umfeld: Wer Preisuntergrenzen versteht, trifft bessere Entscheidungen – sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus strategischer Sicht.
—
Bildquelle(n): Mojo_cp / Canva

In der IT aufgewachsen; im Marketing zuhause. Zertifizierter Datenschutzbeauftragter, Unternehmergeist und kreativer Content Creator.